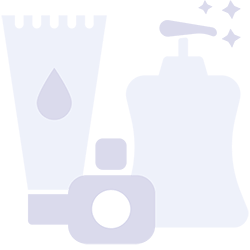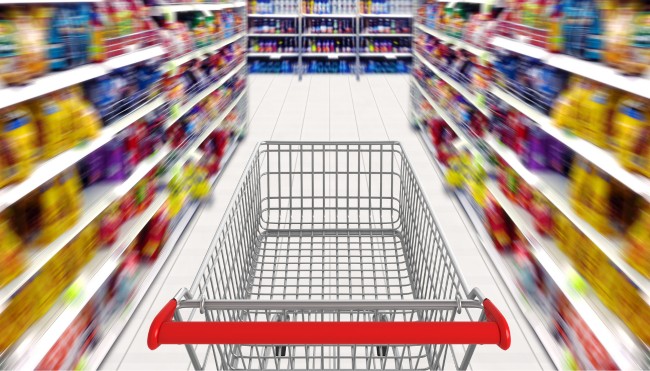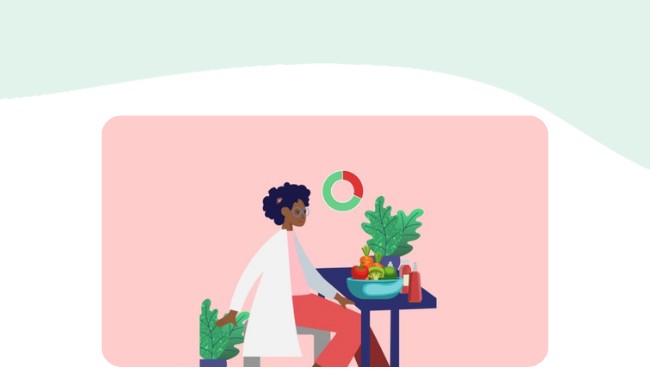Inhaltsstoffe
*Aufgrund zeitlicher Verzögerungen und Tippfehlern kann nicht garantiert werden, dass die auf dieser Seite publizierten Zutaten bzw. Nährwerte mit den Informationen auf der Etikette des Produktes übereinstimmen. Relevant sind nur die Angaben auf der Etikette des Produktes. Im Fall von Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren.
CO2 Fußabdruck
 Nicht Verfügbar
Nicht Verfügbar
Keine Labels & Gütesiegel vorhanden
Produktinformationen
Weitere Informationen
Kategorie
FruchtgeleeMenge / Größe
Hersteller / Vertrieb
Strichcode-Nummer
Herkunft
Marke
Erfasst von User
Letzte Änderung von User
anzeigen
Angaben verbessern
Produkt bearbeitenLebens & Ernährungsweise
Einschätzung
Dieses Produkt ist glutenfrei. Es ist für Personen mit Glutenunverträglichkeit und Zöliakie bedenkenlos.
Auf welchen Informationen basiert die Einschätzung?
Dieses Produkt wird als glutenfrei erkannt, weil kein Inhaltsstoff glutenhaltig ist und keine Unverträglichkeitsinformationen zu Gluten vorhanden sind.
Hinweis zur Einschätzung
Die Einschätzung beruht auf der Analyse der Verpackungsangaben, die entweder aus Produktdatenbanken stammen und zum Teil von Nutzer:innen erfasst wurden. Verwenden die Verpackungsangaben keine üblichen Formulierungen zum Glutengehalt oder sind die Angaben unvollständig oder nicht korrekt erfasst worden oder veraltet, so kann die Einschätzung falsch sein. CodeCheck.info kann nicht für die Richtigkeit der Angaben garantieren.
Sollte die Einschätzung nicht richtig sein, so kannst du die Verpackungsangaben selbst korrigieren oder uns eine Nachricht senden.
Was ist Gluten?
Gluten ist ein Klebereiweiß, das in vielen Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen und Hafer vorkommt. Mais, Reis, Buchweizen und Hirse sind hingegen glutenfrei. Gluten sorgt für die Backfähigkeit der Getreidemehle, ist resistent gegen Hitze oder Kälte und kann somit nicht durch Backen oder Einfrieren zerstört werden.
Was ist Zöliakie?
Die Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einer chronischen Erkrankung der Dünndarmschleimhaut auf Grund einer Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Gluten führt. Die Unverträglichkeit bleibt lebenslang bestehen, ist zum Teil erblich und kann derzeit nicht ursächlich behandelt werden.
Einschätzung
Dieses Produkt ist laktosefrei. Es ist für Personen mit Laktose-Intoleranz bedenkenlos.
Auf welchen Informationen basiert die Einschätzung?
Dieses Produkt wird als laktosefrei erkannt, weil kein Inhaltsstoff laktosehaltig ist und keine Unverträglichkeitsinformationen zu Laktose vorhanden sind.
Hinweis zur Einschätzung
Die Einschätzung beruht auf der Analyse der Verpackungsangaben, die entweder aus Produktdatenbanken stammen und zum Teil von Nutzer:innen erfasst wurden. Verwenden die Verpackungsangaben keine üblichen Formulierungen zum Laktosegehalt oder sind die Angaben unvollständig oder nicht korrekt erfasst worden oder veraltet, so kann die Einschätzung falsch ein. Codecheck.info kann nicht für die Richtigkeit der Angaben garantieren.
Sollte die Einschätzung nicht richtig sein, so kannst du die Verpackungsangaben selbst korrigieren oder uns eine Nachricht senden.
Ein Laktosegehalt, welcher kleiner als 0,1 g pro 100 g des essbaren Anteils ist, wird als laktosefrei eingestuft.
Was ist Laktose?
Laktose, auch Milchzucker, ist ein Zweifachzucker aus Glukose und Galaktose, der unter anderem in Kuhmilch, Schafsmilch, Ziegenmilch und Stutenmilch vorkommt. Laktose ist auch Bestandteil aller Produkte, die aus Milch hergestellt werden, wie Käse, Joghurt, Buttermilch oder Sahne. Milchzucker steckt zudem als technischer Hilfsstoff in vielen Lebensmitteln. Industriell hergestellte Lebensmittel wie Wurst, Fertiggerichte, Salatsaucen, Trockengebäck, Süßstoffe oder Müslimischungen können Laktose enthalten.
Was ist Laktose-Intoleranz?
Bei der Laktose-Intoleranz (Milchzucker-Unverträglichkeit) liegt ein Mangel des Enzyms Laktase vor. Infolgedessen kann die Laktose im Dünndarm nicht gespalten und verdaut werden, so dass der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm gelangt. Dies führt zu Symptomen wie Völlegefühl, Bauchkrämpfen, Blähungen und Durchfall nach dem Genuss von Milch und Milchprodukten. Die Laktose-Intoleranz ist nicht mit einer Milchallergie zu verwechseln, welche eine Reaktion des Immunsystems auf das körperfremde Eiweiß der Milch ist.
Einschätzung
Dieses Produkt enthält Bestandteile tierischen Ursprungs. Es ist für Personen mit einer veganen Lebensweise nicht geeignet.
Auf welchen Informationen basiert die Einschätzung?
Dieses Produkt enthält Bestandteile tierischen Ursprungs, weil die Inhaltsstoffe „e901“ und „e904“ tierischen Ursprungs sind.
Hinweis zur Einschätzung
Die Einschätzung beruht auf der Analyse der Verpackungsangaben, die entweder aus Produktdatenbanken stammen und zum Teil von Nutzer:innen erfasst wurden. Verwenden die Verpackungsangaben keine üblichen Formulierungen zum Vegan-Status oder sind die Angaben unvollständig bzw. nicht korrekt erfasst worden oder veraltet, so kann die Einschätzung falsch sein. Codecheck.info kann nicht für die Richtigkeit der Angaben garantieren. Sollte die Einschätzung nicht richtig sein, so kannst du die Verpackungsangaben selbst korrigieren oder uns eine Nachricht senden.
Die Einschätzung beurteilt nicht ob die Inhaltsstoffe oder Produkte in Tierversuchen getestet worden sind.
Was ist vegan?
Veganismus ist eine Lebens- und Ernährungsweise. Dabei wird auf den Konsum von Produkten verzichtet, die tierischen Ursprungs sind oder Bestandteile tierischen Ursprungs beinhalten. Dazu zählen Lebensmittel und Kosmetika, die Inhaltsstoffe aus Fleisch, Fisch, Meerestieren, Milch, Ei und Honig enthalten. Einige Veganer verzichten zusätzlich auf Zoobesuche und den Besuch von Zirkussen mit Tiervorstellungen sowie auf Kleidung zum Beispiel aus Seide oder Leder.
Wieso vegan?
Veganismus wird meistens aus gesundheitlichen Aspekten und ethischer Überzeugung betrieben. Gründe dafür können unter anderem Tierschutz, Tierrecht und Umweltschutz sein. Aber auch nicht vegan lebende Menschen greifen zu veganen Alternativen, um ihren Verbrauch von tierischen Produkten zu reduzieren.
Einschätzung
Dieses Produkt enthält Bestandteile von toten Tieren. Es ist für Personen mit einer vegetarischen Lebensweise nicht geeignet.
Auf welchen Informationen basiert die Einschätzung?
Dieses Produkt enthält Bestandteile von toten Tieren, weil der Inhaltsstoff „e904“ von toten Tieren stammt.
Hinweis zur Einschätzung
Die Einschätzung beruht auf der Analyse der Verpackungsangaben, die entweder aus Produktdatenbanken stammen und zum Teil von Nutzer:innen erfasst wurden. Sind die Verpackungsangaben unvollständig oder nicht korrekt erfasst worden oder veraltet, so kann die Einschätzung falsch sein. Codecheck.info kann nicht für die Richtigkeit der Angaben garantieren. Sollte die Einschätzung nicht richtig sein, kannst du uns eine Nachricht schicken oder die Verpackungsangaben ganz einfach selbst korrigieren.
Was bedeutet Vegetarisch?
Das Wort vegetarisch leitet sich vom lateinischen "vegetare" (= beleben) bzw. "vegetus" (= frisch, lebendig, belebt) ab. Vegetarismus kennzeichnet daher als eine Lebens- und Ernährungsweise, die "lebendig" und "belebend" ist. Vegetarier essen deshalb neben pflanzlichen Nahrungsmitteln ausschließlich solche Produkte, die von lebenden Tieren stammen. Dazu zählen mitunter Milch, Eier und Honig. Gemieden werden hingegen Fleisch und Fisch, aber auch alle daraus hergestellten Produkte, wie z. B. Säfte, Joghurts oder Cornflakes mit Gelatine, Schmalz oder Käse mit tierischem Lab. Lab muss bisher nicht deklariert werden, da es international nicht als Lebensmittelzusatz-, sondern als Produktionshilfsstoff eingestuft wird. Tierisches Lab wird aus der Magenschleimhaut junger Kälber entnommen und weiterverarbeitet. Als Vegetarier muss man sich also genauestens informieren, welchen Käse tierisches Lab enthält. Wenn ein Hersteller auf seinem Produkt angibt, dass der Käse Lab enthält, handelt es sich um einen freiwilligen Hinweis. Dieser wird von Codecheck erfasst.
Warum Vegetarisch?
Vegetarismus wird meistens aus gesundheitlichen Aspekten und ethischer Überzeugung betrieben. Gründe dafür können unter anderem Tierschutz, Tierrecht und Umweltschutz sein. Aber auch nicht vegetarisch lebende Menschen, sogenannte Flexitarier, greifen immer häufiger zu vegetarischen Alternativen, um ihren Verbrauch von tierischen Produkten zu reduzieren. Eine noch konsequentere Form des Vegetarismus ist der Veganismus.
Zutaten
Inhaltsstoffe
*Aufgrund zeitlicher Verzögerungen und Tippfehlern kann nicht garantiert werden, dass die auf dieser Seite publizierten Zutaten bzw. Nährwerte mit den Informationen auf der Etikette des Produktes übereinstimmen. Relevant sind nur die Angaben auf der Etikette des Produktes. Im Fall von Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren.
Inhaltsstoffe
Weitere Namen
E129
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Das rot färbende Allurarot gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe.
Herstellung
Allurarot AC wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entsteht die für alle Azofarbstoffe charakteristische Azogruppe aus zwei Stickstoffatomen. Unter Allurarot wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Das Calcium- und Kaliumsalz sowie der Aluminiumlack sind jedoch ebenfalls zugelassen.
Problem
Allergieauslösend bei Personen, die auf Aspirin (Acetylsalicylsäure) oder Benzoesäure (E 210) allergisch reagieren. Für Menschen mit Pseudoallergien, z. B. Asthma oder Neurodermitis bedenklich. Wenig Untersuchungen veröffentlicht. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E110
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der künstliche Farbstoff Gelborange färbt Lebensmittel gelblich orange. Er gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe, ist wasserlöslich und auch in saurer Umgebung sowie unter hohen Temperaturen farbecht. Ascorbinsäure (Vitamin C) wirkt jedoch entfärbend.
Herstellung
Gelborange S wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entsteht die für alle Azofarbstoffe charakteristische Azogruppe aus zwei Stickstoffatomen. Unter Gelborange S wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Die Calcium- und Kaliumsalze des Stoffes sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Im Tierversuch wurden bei hoher Dosis Nierentumore festgestellt. Allergieauslösend, besonders bei Personen, die empfindlich auf Aspirin oder Benzoesäure (E 210) reagieren. Ist vermutlich einer der Auslöser von Neurodermitis oder Asthma. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Vom Verzehr größerer Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E102, CI 19140
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der synthetische Farbstoff Tartrazin färbt Lebensmittel zitronengelb. Er gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe, ist wasserlöslich und auch in saurer Umgebung sowie unter hohen Temperaturen farbecht.
Herstellung
Tartrazin wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entstehen die für alle Azofarbstoffe charakteristischen Azogruppen aus zwei Stickstoffatomen. Unter Tartrazin wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Die Calcium- und Kaliumsalze sowie der Aluminiumlack des Stoffes sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Allergieauslösend bei Personen, die auf Aspirin (Acetylsalicylsäure) oder Benzoesäure (E210) allergisch reagieren. Für Menschen mit Pseudoallergien, z. B. Asthma oder Neurodermitis bedenklich. Nebenwirkungen: Atemschwierigkeiten, Hautausschläge und verschwommenes Sehvermögen. In Einzelfällen allergieauslösend. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Vom Verzehr größerer Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E171
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Titan ist ein natürlich vorkommendes Metall. In der Lebensmittelindustrie wird Titandioxid als weißer Farbstoff eingesetzt. Im Unterschied zu den in Flüssigkeiten löslichen Farbstoffen ist das Pigment Titandioxid jedoch nicht löslich. Die Partikel werden vielmehr sehr fein in ihrem Medium verteilt, ohne aber ihre chemische Zusammensetzung zu ändern. Titandioxid ist beständig gegen Licht, Hitze und Säuren.
Herstellung
Titandioxid wird mit Hilfe chemischer Reaktionen aus dem natürlich vorkommenden Eisenerz Ilmenit (Titaneisen) gewonnen.
Problem
Bei Tierversuchen wurden Erkrankungen des Immunsystems und Dickdarmschädigungen ausgelöst, bei Mäusen traten zelluläre Veränderungen auf. Krebserzeugende Wirkungen unklar. Laut französischer Gesundheitsbehörde ist keine Risikobewertung möglich, deshalb wird die Zulassung dort ab 2020 für ein Jahr ausgesetzt. Weitere unabhängige Forschung unbedingt erforderlich.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E150d, Zuckerkulör
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Ammonsulfit-Zuckerkulör ist eine Form der Zuckerkulör (E 150 a).
Herstellung
Wenn Haushaltszucker, Glucose, Fructose oder Invertzucker unter Zuhilfenahme von Reaktionsbeschleunigern kontrolliert auf 120 bis 150 °C erhitzt werden, entsteht Zuckerkulör. Die jeweiligen Reaktionsbeschleuniger sind das Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen Zuckerkulöre. Im Falle der Ammoniumsulfit-Zuckerkulör kommen Sulfit- und Ammoniumverbindungen zum Einsatz.
Problem
Kann eine giftige Verbindung enthalten, die im Tierversuch in großen Konzentrationen blutbildverändernd und krampfauslösend wirkte. Für diese Verunreinigungen bestehen gesetzliche Grenzwerte. Steht insbesondere in den USA unter Krebsverdacht. Vom häufigen Verzehr ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E330, Zitronensäure
Gruppe
Antioxidationsmittel, Komplexbildner, Säuerungsmittel, Säureregulator, Schmelzsalz
Erläuterung
Als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) ist Citronensäure Bestandteil jeder lebenden Zelle. Der menschliche Stoffwechsel setzt täglich ein Kilogramm davon um. Neben ihrer Funktion als meistgebrauchtes Säuerungsmittel wird Citronensäure in der Lebensmittelindustrie für eine Reihe weiterer technologischer Anwendungen genutzt: Wegen ihrer Fähigkeit, mit Schwermetallen Komplexe zu bilden, erhält sie als Antioxidationsmittel Fette, Farben, Aromen und Vitamingehalt vieler Lebensmittel. Beim Sterilisieren von Sahne und Milch sowie beim Schmelzen von Käse verhindert sie das Gerinnen des Eiweißes. Citronensäure unterstützt die Umrötung von Fleisch (siehe: Kaliumnitrit E 249) und verbessert zudem die Backeigenschaften von Teigen und Mehlen.
Herstellung
Citronensäure wird biotechnologisch mit Hilfe von Mikroorganismen, insbesondere des Schimmelpilzes Aspergillus niger hergestellt. Als Nährmedium dienen Glucose oder Melasse.
Problem
Der zunehmende Einsatz in Getränken und „sauren“ Süßigkeiten führt immer häufiger zu Zahnschäden bei Kindern und Erwachsenen, weil der Zahnschmelz von der Säure angegriffen und hierdurch die Entstehung von Karies gefördert wird, z. B. durch Eistee in Nuckelflaschen für Kleinkinder. Vom Verzehr in größeren Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E132, Indigo-Karmin
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Das dunkelblau färbende Indigotin ist eng mit dem natürlich vorkommenden Indigo verwandt. Wegen eines kleinen chemischen Unterschieds ist Indigotin jedoch wasserlöslich. Der Farbstoff bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil, ist jedoch nicht säurebeständig.
Herstellung
Über viele Jahrhunderte wurde der Farbstoff Indigo aus Färberwaid oder Indigo-Pflanzen gewonnen. Seit 1897 die Synthese des Indigotins gelang, wird der Farbstoff überwiegend in einem mehrstufigen chemischen Prozess aus Phenylglycin gewonnen. Unter Indigotin wird das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Das Kalium- und Calciumsalz sowie der Aluminiumlack von Indigotin sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Bei gleichzeitiger Aufnahme von Natriumnitrit und Indigotin wurden im Tierversuch in hoher Dosis Erbgutschäden festgestellt. Mögliche Kombinationen sind z. B. Schinken oder Wurst und gefärbte Süßwaren oder Liköre. In Einzelfällen allergieauslösend.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E100, CI 75300
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der Farbstoff Kurkumin ist gelb bis orange. Er wird natürlicherweise im Wurzelstock der zu den Ingwergewächsen gehörenden Gelbwurz (Kurkuma, Curcuma) gebildet. Kurkumin wird frisch, vor allem aber getrocknet als Gewürz und Färbemittel z.B. in Currypulver verwendet. Es ersetzt in der Küche oft den sehr viel teureren Safran. Im Unterschied zu diesem ist Kurkumin jedoch wenig lichtbeständig.
Herstellung
Kurkumin kann durch Extraktion aus der Kurkumawurzel gewonnen werden. Üblich ist aber auch die synthetische Herstellung sowie die fermentative Kurkumin-Gewinnung mit Hilfe von Bakterien. Häufiger als der isolierte Farbstoff kommen Extrakte der Kurkuma-Wurzel oder Kurkuma-Pulver zum Einsatz. Sie gelten als färbendes Gewürz und tragen daher keine E-Nummer.
Problem
Fördert in hoher Dosis den Gallenfluss. In Einzelfällen allergieauslösend.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E331, Mononatriumcitrat, Dinatriumcitrat, Trinatriumcitrat, Salze der Citronensäure
Gruppe
Komplexbildner, Säuerungsmittel, Säureregulator, Schmelzsalz
Erläuterung
Natriumcitrate sind Salze der Citronensäure (E 330), die als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) Bestandteil jeder lebenden Zelle ist. Der menschliche Körper setzt täglich etwa 2 kg Citrate um. Aus Citronensäure können Mono-Natriumcitrat, Di-Natriumcitrat und Tri-Natriumcitrat hergestellt werden, die jeweils unterschiedliche Säurewirkungen haben.
Natriumcitrate werden insbesondere als Regulator für Geliervorgänge mit Pektin eingesetzt.
Herstellung
Natriumcitrate werden aus Citronensäure (E 330) hergestellt.
Problem
Der zunehmende Einsatz in Getränken und „sauren“ Süßigkeiten führt immer häufiger zu Zahnschäden bei Kindern und Erwachsenen, weil der Zahnschmelz von der Säure angegriffen wird, z. B. durch Eistee in Nuckelflaschen für Kleinkinder. Vom Verzehr in größeren Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E901, Bienenwachs weiß und gelb
Gruppe
Füllstoff, Trägerstoff, Trennmittel, Überzugsmittel
Erläuterung
Bienen scheiden ein Sekret aus, das überwiegend aus Fettsäureestern besteht. Dieses so genannte Bienenwachs ist das Baumaterial ihrer Waben. Das gelb bis weiß gefärbte Wachs ist sehr wertvoll und wird daher oft mit anderen Wachsen verschnitten. Es wird vom Körper nicht aufgenommen. Als Überzugsmittel bzw. Oberflächenbehandlungsmittel verhindert es zum Beispiel bei Obst den Verlust von Feuchtigkeit durch die Schale. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Für die Gewinnung von Bienenwachs werden die vom Honig befreiten Waben zunächst geschmolzen. Das Rohwachs wird im Anschluss bis zur Lebensmittelqualität gereinigt.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E133, Patentblau AE, Amidoblau AE
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der wasserlösliche blaue Farbstoff gehört wie Patentblau V (E 131) zur Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe, die durch ein zentrales Kohlenstoffatom und drei Phenylreste gekennzeichnet sind. Brillantblau FCF ist wasserlöslich und stabil bei Hitze und im Licht. In saurer Umgebung schlägt die Farbe von Blau nach Grün um.
Herstellung
Brillantblau FCF wird in einer mehrstufigen chemischen Reaktion synthetisiert. Als Brillantblau FCF wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Auch das Calcium- und Kaliumsalz sowie der Aluminiumlack des Farbstoffes sind zugelassen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E903, Karnaubawachs, Brasilwachs
Gruppe
Trennmittel, Überzugsmittel
Erläuterung
Die in Brasilien beheimatete Carnaubapalme (Copernica cerifera) bildet ein bräunlich-grünliches Wachs. Das so genannte Carnaubawachs ist härter als Bienen- und Candelillawachs (E 901, E 902), haftet gut, verleiht Oberflächen Glanz und verstärkt ihre Farbe. Es wird insbesondere zur Oberflächenbehandlung von Früchten eingesetzt, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Zur Herstellung von Carnaubawachs wird zunächst der Wachsstaub von den Blättern der Wachspalme gebürstet und geschmolzen. Das Rohwachs wird anschließend gereinigt und gegebenenfalls gebleicht.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E322, Lezithin, Phosphatidylcholin, Rohlecithin
Gruppe
Emulgator, Antioxidationsmittel, Stabilisator, Mehlbehandlungsmittel
Erläuterung
Lecithin kommt in jeder lebenden Zelle vor. Als natürlicher fettähnlicher Stoff gehört es zur Gruppe der Phospholipide. Wegen seines bipolaren Aufbaus ist Lecithin ein wichtiger Baustein der Zellwände. Besonders Knochenmark, Nervengewebe, Herz und Leber sind reich an Lecithinen. Die Stoffe beeinflussen darüber hinaus den Transport von Fetten und Cholesterin im Blut und wirken als Bestandteil der Gallenflüssigkeit an der Fettverdauung mit. Auch in Lebensmitteln wie Eigelb, Mohrrüben, Hülsenfrüchten oder Pflanzenölen ist Lecithin reichlich enthalten.
Lecithin ermöglicht als Emulgator, dass sich Fett- und Wasser-Phasen eines Lebensmittels nicht trennen. Als Mehlbehandlungsmittel verbessert es die Knet- und Formeigenschaften von Teigen und verlangsamt das Altbackenwerden von Gebäck. In Margarine sorgt Lecithin dafür, dass sie in der Pfanne nicht spritzt. Als Antioxidationsmittel schützt die Fette zudem vor den verderbenden Einflüssen des Sauerstoffs. Diese technologischen Wirkungen nutzen Köche, in dem sie im geeigneten Moment zu Ei, Butter und Sahne greifen.
Herstellung
Lecithin wird überwiegend aus Sojabohnen gewonnen. Auch Sonnenblumen, Raps, Erdnüssen, Mais und Eigelb können Rohstoffe sein. Herstellung aus genverändertem Soja (dann Kennzeichnungspflicht), mit Hilfe der Gentechnik oder in Nanogröße (aus Liposomen) möglich.
Das so gewonnene natürliche Lecithin kann ebenso in Lebensmitteln eingesetzt werden, wie die Lecithine, die durch chemische Modifikation daraus gewonnen werden. Die chemisch modifizierten Lecithine werden auf besondere technologische Anforderungen zugeschnitten und erweitern so das Anwendungsgebiet des Stoffes deutlich. So ist etwa Lysolecithin besonders hitzestabil, während andere Modifikationen die Emulgatoreigenschaften des Lecithins verbessern. Modifizierte Lecithine werden ebenfalls als Lecithin E 322 gekennzeichnet.
Problem
Kann aus Sojabohnen, Mais, Erdnüssen, Eigelb, Sonnenblumen- oder Rapsöl hergestellt sein. Daher Pflicht der Allergenkennzeichnung.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E270, D-, L-Milchsäure
Gruppe
Säuerungsmittel
Erläuterung
Milchsäure ist eine natürlich vorkommende organische Säure. Sie entsteht als Zwischenprodukt im Stoffwechsel lebender Zellen. Ihre konservierenden Eigenschaften nutzen Menschen seit Jahrhunderten beim milchsauren Einlegen: Milchsäure senkt den Säuregrad der Lebensmittel und wirkt gegen einige, vorwiegend anaerob (ohne Luftsauerstoff) lebende Bakterien direkt. Zugleich verdrängen Milchsäurebakterien andere Mikroorganismen. Mit ihrem mildsauren Geschmack wird Milchsäure als Säuerungsmittel in Getränken, Süßwaren und Sauerkonserven zur Abrundung des Geschmacks eingesetzt.
In der Natur kommt Milchsäure in zwei Varianten vor. Die beiden Moleküle unterscheiden sich an einer einzigen Stelle, an der ihre Atome unterschiedlich ausgerichtet sind. Diese beiden Varianten haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften. Eine davon wird mit Hilfe polarisierten Lichts, das durch eine Milchsäure-Lösung geschickt wird, nachgewiesen: Rechtsdrehende Milchsäure, wie sie auch im menschlichen Organismus gebildet wird, dreht polarisiertes Licht nach rechts. Diese L(+)-Milchsäure wird vom Körper sehr gut und schnell verdaut. D(-)-Milchsäure dreht polarisiertes Licht dagegen nach links. Diese Milchsäure wird im Körper mit Hilfe eines bestimmten Enzyms zunächst in rechtsdrehende umgewandelt, bevor sie verwertet werden kann.
Herstellung
Milchsäure wird überwiegend mit Hilfe verschiedener Milchsäurebakterien hergestellt. Je nach Art produzieren die Bakterien überwiegend rechts- oder linksdrehende Milchsäure, einige auch ein ausgeglichenes Gemisch aus beiden.
Milchsäure kann auch durch chemische Reaktionen synthetisiert werden.
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das gilt jedoch nur für D-Milchsäure. In Säuglingsnahrung ist nur die unbedenkliche Form L(+)- Milchsäure zugelassen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E325, Salze der Milchsäure
Gruppe
Säureregulator, Feuchthaltemittel
Erläuterung
Natriumlactat ist das Natriumsalz der Milchsäure (E 270), die als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels in allen lebenden Zellen zu finden ist. Im Gegensatz zur Milchsäure wirkt Natriumlactat kaum gegen Mikroorganismen. Es wird zur Regulation des Säuregrades von Lebensmitteln oder ihren Zutaten, wie im Falle von Schmelzsalzen, eingesetzt.
Herstellung
Natriumlactat wird durch chemische Veränderung aus Milchsäure (E 270) hergestellt. Tierischer oder pflanzlicher Ursprung fraglich
Möglicherweise für Veganer nicht geeignet
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das gilt jedoch nur für D-Milchsäure. In Säuglingsnahrung ist nur die unbedenkliche Form (L+ Milchsäure) zugelassen.
Tierische Herkunft aus Milch oder Molke möglich, dann Pflicht der Allergenkennzeichnung.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E904
Gruppe
Überzugsmittel
Erläuterung
Die harzartigen Ausscheidungen der weiblichen Gummilackschildläuse (Kerria lacca) werden als Schellack bezeichnet. Die Schildläuse sondern das Sekret zum Schutz ihrer Brut auf ihrer gesamten Körperfläche ab und überziehen so auch die Äste und Zweige der Bäume, auf denen sie leben. Der Wirtsbaum der parasitär lebenden Lackschildläuse wächst in Südostasien. Insbesondere in Indien und China wird Schellack gewonnen. Das spröde, gelblich-transparente Harz diente in vergangenen Jahrhunderten als Schutzlack für Möbel und war das Material für die ersten Schallplatten. In der Lebensmittelindustrie wird es heute meist in Kombination mit Bienenwachs (E 901)als Überzugsmittel für frische Früchte verwendet, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Durch Zerkleinern, Trocknen, Ausschmelzen und Reinigen wird Schellack direkt von den Ästen und Zweigen der Bäume gewonnen, auf denen die Lackschildlaus lebt. Für ein Kilogramm des Lacks ist das Sekret von etwa 300.000 Lackschildläusen nötig. Für Vegetarier nicht geeignet.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E296, Apfelsäure
Gruppe
Säuerungsmittel
Erläuterung
Äpfelsäure kommt als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) in allen lebenden Zellen vor. Im menschlichen Stoffwechsel wird täglich 1 kg davon umgesetzt. Die organische Säure schmeckt stärker sauer als Citronen- und Weinsäure (E 330, E 334) und harmoniert gut mit herben Aromen. Äpfelsäure unterstützt die Wirkung von Antioxidantien und hemmt Enzyme, die bei geschnittenem Obst und Gemüse eine Braunverfärbung verursachen. Sie wird daher beim industriellen Blanchieren eingesetzt.
Äpfelsäure kann in zwei geringfügig verschieden aufgebauten Varianten vorliegen: An einer Stelle sind die Atome dieser beiden Moleküle unterschiedlich ausgerichtet. In der Natur wird ausschließlich die L-Form gebildet. Bei der großtechnischen Herstellung entsteht ein Gemisch aus L- und D-Äpfelsäure. Menschen verfügen aber über Enzyme, die die D- in die L-Form umwandeln und so dem Stoffwechsel zugänglich machen können. Als Zusatzstoff aufgenommene Äpfelsäure wird daher vollständig verwertet.
Herstellung
Äpfelsäure kann durch chemische Synthese aus Maleinsäure oder Fumarsäure hergestellt werden. Dabei entsteht ein Gemisch aus D- und L-Äpfelsäure. Reine L-Äpfelsäure entsteht, wenn sie mit Hilfe von äpfelsäureproduzierenden Mikroorganismen bzw. bestimmten Enzymen hergestellt wird.
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E129
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Das rot färbende Allurarot gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe.
Herstellung
Allurarot AC wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entsteht die für alle Azofarbstoffe charakteristische Azogruppe aus zwei Stickstoffatomen. Unter Allurarot wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Das Calcium- und Kaliumsalz sowie der Aluminiumlack sind jedoch ebenfalls zugelassen.
Problem
Allergieauslösend bei Personen, die auf Aspirin (Acetylsalicylsäure) oder Benzoesäure (E 210) allergisch reagieren. Für Menschen mit Pseudoallergien, z. B. Asthma oder Neurodermitis bedenklich. Wenig Untersuchungen veröffentlicht. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E110
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der künstliche Farbstoff Gelborange färbt Lebensmittel gelblich orange. Er gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe, ist wasserlöslich und auch in saurer Umgebung sowie unter hohen Temperaturen farbecht. Ascorbinsäure (Vitamin C) wirkt jedoch entfärbend.
Herstellung
Gelborange S wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entsteht die für alle Azofarbstoffe charakteristische Azogruppe aus zwei Stickstoffatomen. Unter Gelborange S wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Die Calcium- und Kaliumsalze des Stoffes sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Im Tierversuch wurden bei hoher Dosis Nierentumore festgestellt. Allergieauslösend, besonders bei Personen, die empfindlich auf Aspirin oder Benzoesäure (E 210) reagieren. Ist vermutlich einer der Auslöser von Neurodermitis oder Asthma. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Vom Verzehr größerer Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E102, CI 19140
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der synthetische Farbstoff Tartrazin färbt Lebensmittel zitronengelb. Er gehört zur Gruppe der Azofarbstoffe, ist wasserlöslich und auch in saurer Umgebung sowie unter hohen Temperaturen farbecht.
Herstellung
Tartrazin wird in einem mehrstufigen Prozess, der so genannten Azokupplung, chemisch synthetisiert. Dabei entstehen die für alle Azofarbstoffe charakteristischen Azogruppen aus zwei Stickstoffatomen. Unter Tartrazin wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Die Calcium- und Kaliumsalze sowie der Aluminiumlack des Stoffes sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Allergieauslösend bei Personen, die auf Aspirin (Acetylsalicylsäure) oder Benzoesäure (E210) allergisch reagieren. Für Menschen mit Pseudoallergien, z. B. Asthma oder Neurodermitis bedenklich. Nebenwirkungen: Atemschwierigkeiten, Hautausschläge und verschwommenes Sehvermögen. In Einzelfällen allergieauslösend. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Vom Verzehr größerer Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E171
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Titan ist ein natürlich vorkommendes Metall. In der Lebensmittelindustrie wird Titandioxid als weißer Farbstoff eingesetzt. Im Unterschied zu den in Flüssigkeiten löslichen Farbstoffen ist das Pigment Titandioxid jedoch nicht löslich. Die Partikel werden vielmehr sehr fein in ihrem Medium verteilt, ohne aber ihre chemische Zusammensetzung zu ändern. Titandioxid ist beständig gegen Licht, Hitze und Säuren.
Herstellung
Titandioxid wird mit Hilfe chemischer Reaktionen aus dem natürlich vorkommenden Eisenerz Ilmenit (Titaneisen) gewonnen.
Problem
Bei Tierversuchen wurden Erkrankungen des Immunsystems und Dickdarmschädigungen ausgelöst, bei Mäusen traten zelluläre Veränderungen auf. Krebserzeugende Wirkungen unklar. Laut französischer Gesundheitsbehörde ist keine Risikobewertung möglich, deshalb wird die Zulassung dort ab 2020 für ein Jahr ausgesetzt. Weitere unabhängige Forschung unbedingt erforderlich.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E150d, Zuckerkulör
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Ammonsulfit-Zuckerkulör ist eine Form der Zuckerkulör (E 150 a).
Herstellung
Wenn Haushaltszucker, Glucose, Fructose oder Invertzucker unter Zuhilfenahme von Reaktionsbeschleunigern kontrolliert auf 120 bis 150 °C erhitzt werden, entsteht Zuckerkulör. Die jeweiligen Reaktionsbeschleuniger sind das Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen Zuckerkulöre. Im Falle der Ammoniumsulfit-Zuckerkulör kommen Sulfit- und Ammoniumverbindungen zum Einsatz.
Problem
Kann eine giftige Verbindung enthalten, die im Tierversuch in großen Konzentrationen blutbildverändernd und krampfauslösend wirkte. Für diese Verunreinigungen bestehen gesetzliche Grenzwerte. Steht insbesondere in den USA unter Krebsverdacht. Vom häufigen Verzehr ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E330, Zitronensäure
Gruppe
Antioxidationsmittel, Komplexbildner, Säuerungsmittel, Säureregulator, Schmelzsalz
Erläuterung
Als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) ist Citronensäure Bestandteil jeder lebenden Zelle. Der menschliche Stoffwechsel setzt täglich ein Kilogramm davon um. Neben ihrer Funktion als meistgebrauchtes Säuerungsmittel wird Citronensäure in der Lebensmittelindustrie für eine Reihe weiterer technologischer Anwendungen genutzt: Wegen ihrer Fähigkeit, mit Schwermetallen Komplexe zu bilden, erhält sie als Antioxidationsmittel Fette, Farben, Aromen und Vitamingehalt vieler Lebensmittel. Beim Sterilisieren von Sahne und Milch sowie beim Schmelzen von Käse verhindert sie das Gerinnen des Eiweißes. Citronensäure unterstützt die Umrötung von Fleisch (siehe: Kaliumnitrit E 249) und verbessert zudem die Backeigenschaften von Teigen und Mehlen.
Herstellung
Citronensäure wird biotechnologisch mit Hilfe von Mikroorganismen, insbesondere des Schimmelpilzes Aspergillus niger hergestellt. Als Nährmedium dienen Glucose oder Melasse.
Problem
Der zunehmende Einsatz in Getränken und „sauren“ Süßigkeiten führt immer häufiger zu Zahnschäden bei Kindern und Erwachsenen, weil der Zahnschmelz von der Säure angegriffen und hierdurch die Entstehung von Karies gefördert wird, z. B. durch Eistee in Nuckelflaschen für Kleinkinder. Vom Verzehr in größeren Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E132, Indigo-Karmin
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Das dunkelblau färbende Indigotin ist eng mit dem natürlich vorkommenden Indigo verwandt. Wegen eines kleinen chemischen Unterschieds ist Indigotin jedoch wasserlöslich. Der Farbstoff bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil, ist jedoch nicht säurebeständig.
Herstellung
Über viele Jahrhunderte wurde der Farbstoff Indigo aus Färberwaid oder Indigo-Pflanzen gewonnen. Seit 1897 die Synthese des Indigotins gelang, wird der Farbstoff überwiegend in einem mehrstufigen chemischen Prozess aus Phenylglycin gewonnen. Unter Indigotin wird das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Das Kalium- und Calciumsalz sowie der Aluminiumlack von Indigotin sind ebenfalls zugelassen.
Problem
Bei gleichzeitiger Aufnahme von Natriumnitrit und Indigotin wurden im Tierversuch in hoher Dosis Erbgutschäden festgestellt. Mögliche Kombinationen sind z. B. Schinken oder Wurst und gefärbte Süßwaren oder Liköre. In Einzelfällen allergieauslösend.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E100, CI 75300
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der Farbstoff Kurkumin ist gelb bis orange. Er wird natürlicherweise im Wurzelstock der zu den Ingwergewächsen gehörenden Gelbwurz (Kurkuma, Curcuma) gebildet. Kurkumin wird frisch, vor allem aber getrocknet als Gewürz und Färbemittel z.B. in Currypulver verwendet. Es ersetzt in der Küche oft den sehr viel teureren Safran. Im Unterschied zu diesem ist Kurkumin jedoch wenig lichtbeständig.
Herstellung
Kurkumin kann durch Extraktion aus der Kurkumawurzel gewonnen werden. Üblich ist aber auch die synthetische Herstellung sowie die fermentative Kurkumin-Gewinnung mit Hilfe von Bakterien. Häufiger als der isolierte Farbstoff kommen Extrakte der Kurkuma-Wurzel oder Kurkuma-Pulver zum Einsatz. Sie gelten als färbendes Gewürz und tragen daher keine E-Nummer.
Problem
Fördert in hoher Dosis den Gallenfluss. In Einzelfällen allergieauslösend.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E331, Mononatriumcitrat, Dinatriumcitrat, Trinatriumcitrat, Salze der Citronensäure
Gruppe
Komplexbildner, Säuerungsmittel, Säureregulator, Schmelzsalz
Erläuterung
Natriumcitrate sind Salze der Citronensäure (E 330), die als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) Bestandteil jeder lebenden Zelle ist. Der menschliche Körper setzt täglich etwa 2 kg Citrate um. Aus Citronensäure können Mono-Natriumcitrat, Di-Natriumcitrat und Tri-Natriumcitrat hergestellt werden, die jeweils unterschiedliche Säurewirkungen haben.
Natriumcitrate werden insbesondere als Regulator für Geliervorgänge mit Pektin eingesetzt.
Herstellung
Natriumcitrate werden aus Citronensäure (E 330) hergestellt.
Problem
Der zunehmende Einsatz in Getränken und „sauren“ Süßigkeiten führt immer häufiger zu Zahnschäden bei Kindern und Erwachsenen, weil der Zahnschmelz von der Säure angegriffen wird, z. B. durch Eistee in Nuckelflaschen für Kleinkinder. Vom Verzehr in größeren Mengen ist abzuraten.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E901, Bienenwachs weiß und gelb
Gruppe
Füllstoff, Trägerstoff, Trennmittel, Überzugsmittel
Erläuterung
Bienen scheiden ein Sekret aus, das überwiegend aus Fettsäureestern besteht. Dieses so genannte Bienenwachs ist das Baumaterial ihrer Waben. Das gelb bis weiß gefärbte Wachs ist sehr wertvoll und wird daher oft mit anderen Wachsen verschnitten. Es wird vom Körper nicht aufgenommen. Als Überzugsmittel bzw. Oberflächenbehandlungsmittel verhindert es zum Beispiel bei Obst den Verlust von Feuchtigkeit durch die Schale. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Für die Gewinnung von Bienenwachs werden die vom Honig befreiten Waben zunächst geschmolzen. Das Rohwachs wird im Anschluss bis zur Lebensmittelqualität gereinigt.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E133, Patentblau AE, Amidoblau AE
Gruppe
Farbstoff
Erläuterung
Der wasserlösliche blaue Farbstoff gehört wie Patentblau V (E 131) zur Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe, die durch ein zentrales Kohlenstoffatom und drei Phenylreste gekennzeichnet sind. Brillantblau FCF ist wasserlöslich und stabil bei Hitze und im Licht. In saurer Umgebung schlägt die Farbe von Blau nach Grün um.
Herstellung
Brillantblau FCF wird in einer mehrstufigen chemischen Reaktion synthetisiert. Als Brillantblau FCF wird im Allgemeinen das Natriumsalz der Verbindung verstanden. Auch das Calcium- und Kaliumsalz sowie der Aluminiumlack des Farbstoffes sind zugelassen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E903, Karnaubawachs, Brasilwachs
Gruppe
Trennmittel, Überzugsmittel
Erläuterung
Die in Brasilien beheimatete Carnaubapalme (Copernica cerifera) bildet ein bräunlich-grünliches Wachs. Das so genannte Carnaubawachs ist härter als Bienen- und Candelillawachs (E 901, E 902), haftet gut, verleiht Oberflächen Glanz und verstärkt ihre Farbe. Es wird insbesondere zur Oberflächenbehandlung von Früchten eingesetzt, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Zur Herstellung von Carnaubawachs wird zunächst der Wachsstaub von den Blättern der Wachspalme gebürstet und geschmolzen. Das Rohwachs wird anschließend gereinigt und gegebenenfalls gebleicht.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E322, Lezithin, Phosphatidylcholin, Rohlecithin
Gruppe
Emulgator, Antioxidationsmittel, Stabilisator, Mehlbehandlungsmittel
Erläuterung
Lecithin kommt in jeder lebenden Zelle vor. Als natürlicher fettähnlicher Stoff gehört es zur Gruppe der Phospholipide. Wegen seines bipolaren Aufbaus ist Lecithin ein wichtiger Baustein der Zellwände. Besonders Knochenmark, Nervengewebe, Herz und Leber sind reich an Lecithinen. Die Stoffe beeinflussen darüber hinaus den Transport von Fetten und Cholesterin im Blut und wirken als Bestandteil der Gallenflüssigkeit an der Fettverdauung mit. Auch in Lebensmitteln wie Eigelb, Mohrrüben, Hülsenfrüchten oder Pflanzenölen ist Lecithin reichlich enthalten.
Lecithin ermöglicht als Emulgator, dass sich Fett- und Wasser-Phasen eines Lebensmittels nicht trennen. Als Mehlbehandlungsmittel verbessert es die Knet- und Formeigenschaften von Teigen und verlangsamt das Altbackenwerden von Gebäck. In Margarine sorgt Lecithin dafür, dass sie in der Pfanne nicht spritzt. Als Antioxidationsmittel schützt die Fette zudem vor den verderbenden Einflüssen des Sauerstoffs. Diese technologischen Wirkungen nutzen Köche, in dem sie im geeigneten Moment zu Ei, Butter und Sahne greifen.
Herstellung
Lecithin wird überwiegend aus Sojabohnen gewonnen. Auch Sonnenblumen, Raps, Erdnüssen, Mais und Eigelb können Rohstoffe sein. Herstellung aus genverändertem Soja (dann Kennzeichnungspflicht), mit Hilfe der Gentechnik oder in Nanogröße (aus Liposomen) möglich.
Das so gewonnene natürliche Lecithin kann ebenso in Lebensmitteln eingesetzt werden, wie die Lecithine, die durch chemische Modifikation daraus gewonnen werden. Die chemisch modifizierten Lecithine werden auf besondere technologische Anforderungen zugeschnitten und erweitern so das Anwendungsgebiet des Stoffes deutlich. So ist etwa Lysolecithin besonders hitzestabil, während andere Modifikationen die Emulgatoreigenschaften des Lecithins verbessern. Modifizierte Lecithine werden ebenfalls als Lecithin E 322 gekennzeichnet.
Problem
Kann aus Sojabohnen, Mais, Erdnüssen, Eigelb, Sonnenblumen- oder Rapsöl hergestellt sein. Daher Pflicht der Allergenkennzeichnung.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E270, D-, L-Milchsäure
Gruppe
Säuerungsmittel
Erläuterung
Milchsäure ist eine natürlich vorkommende organische Säure. Sie entsteht als Zwischenprodukt im Stoffwechsel lebender Zellen. Ihre konservierenden Eigenschaften nutzen Menschen seit Jahrhunderten beim milchsauren Einlegen: Milchsäure senkt den Säuregrad der Lebensmittel und wirkt gegen einige, vorwiegend anaerob (ohne Luftsauerstoff) lebende Bakterien direkt. Zugleich verdrängen Milchsäurebakterien andere Mikroorganismen. Mit ihrem mildsauren Geschmack wird Milchsäure als Säuerungsmittel in Getränken, Süßwaren und Sauerkonserven zur Abrundung des Geschmacks eingesetzt.
In der Natur kommt Milchsäure in zwei Varianten vor. Die beiden Moleküle unterscheiden sich an einer einzigen Stelle, an der ihre Atome unterschiedlich ausgerichtet sind. Diese beiden Varianten haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften. Eine davon wird mit Hilfe polarisierten Lichts, das durch eine Milchsäure-Lösung geschickt wird, nachgewiesen: Rechtsdrehende Milchsäure, wie sie auch im menschlichen Organismus gebildet wird, dreht polarisiertes Licht nach rechts. Diese L(+)-Milchsäure wird vom Körper sehr gut und schnell verdaut. D(-)-Milchsäure dreht polarisiertes Licht dagegen nach links. Diese Milchsäure wird im Körper mit Hilfe eines bestimmten Enzyms zunächst in rechtsdrehende umgewandelt, bevor sie verwertet werden kann.
Herstellung
Milchsäure wird überwiegend mit Hilfe verschiedener Milchsäurebakterien hergestellt. Je nach Art produzieren die Bakterien überwiegend rechts- oder linksdrehende Milchsäure, einige auch ein ausgeglichenes Gemisch aus beiden.
Milchsäure kann auch durch chemische Reaktionen synthetisiert werden.
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das gilt jedoch nur für D-Milchsäure. In Säuglingsnahrung ist nur die unbedenkliche Form L(+)- Milchsäure zugelassen.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E325, Salze der Milchsäure
Gruppe
Säureregulator, Feuchthaltemittel
Erläuterung
Natriumlactat ist das Natriumsalz der Milchsäure (E 270), die als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels in allen lebenden Zellen zu finden ist. Im Gegensatz zur Milchsäure wirkt Natriumlactat kaum gegen Mikroorganismen. Es wird zur Regulation des Säuregrades von Lebensmitteln oder ihren Zutaten, wie im Falle von Schmelzsalzen, eingesetzt.
Herstellung
Natriumlactat wird durch chemische Veränderung aus Milchsäure (E 270) hergestellt. Tierischer oder pflanzlicher Ursprung fraglich
Möglicherweise für Veganer nicht geeignet
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das gilt jedoch nur für D-Milchsäure. In Säuglingsnahrung ist nur die unbedenkliche Form (L+ Milchsäure) zugelassen.
Tierische Herkunft aus Milch oder Molke möglich, dann Pflicht der Allergenkennzeichnung.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E904
Gruppe
Überzugsmittel
Erläuterung
Die harzartigen Ausscheidungen der weiblichen Gummilackschildläuse (Kerria lacca) werden als Schellack bezeichnet. Die Schildläuse sondern das Sekret zum Schutz ihrer Brut auf ihrer gesamten Körperfläche ab und überziehen so auch die Äste und Zweige der Bäume, auf denen sie leben. Der Wirtsbaum der parasitär lebenden Lackschildläuse wächst in Südostasien. Insbesondere in Indien und China wird Schellack gewonnen. Das spröde, gelblich-transparente Harz diente in vergangenen Jahrhunderten als Schutzlack für Möbel und war das Material für die ersten Schallplatten. In der Lebensmittelindustrie wird es heute meist in Kombination mit Bienenwachs (E 901)als Überzugsmittel für frische Früchte verwendet, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Früchte, deren Oberfläche so behandelt wurde, tragen den Hinweis „gewachst“.
Herstellung
Durch Zerkleinern, Trocknen, Ausschmelzen und Reinigen wird Schellack direkt von den Ästen und Zweigen der Bäume gewonnen, auf denen die Lackschildlaus lebt. Für ein Kilogramm des Lacks ist das Sekret von etwa 300.000 Lackschildläusen nötig. Für Vegetarier nicht geeignet.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Weitere Namen
E296, Apfelsäure
Gruppe
Säuerungsmittel
Erläuterung
Äpfelsäure kommt als Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels (Citronensäurezyklus) in allen lebenden Zellen vor. Im menschlichen Stoffwechsel wird täglich 1 kg davon umgesetzt. Die organische Säure schmeckt stärker sauer als Citronen- und Weinsäure (E 330, E 334) und harmoniert gut mit herben Aromen. Äpfelsäure unterstützt die Wirkung von Antioxidantien und hemmt Enzyme, die bei geschnittenem Obst und Gemüse eine Braunverfärbung verursachen. Sie wird daher beim industriellen Blanchieren eingesetzt.
Äpfelsäure kann in zwei geringfügig verschieden aufgebauten Varianten vorliegen: An einer Stelle sind die Atome dieser beiden Moleküle unterschiedlich ausgerichtet. In der Natur wird ausschließlich die L-Form gebildet. Bei der großtechnischen Herstellung entsteht ein Gemisch aus L- und D-Äpfelsäure. Menschen verfügen aber über Enzyme, die die D- in die L-Form umwandeln und so dem Stoffwechsel zugänglich machen können. Als Zusatzstoff aufgenommene Äpfelsäure wird daher vollständig verwertet.
Herstellung
Äpfelsäure kann durch chemische Synthese aus Maleinsäure oder Fumarsäure hergestellt werden. Dabei entsteht ein Gemisch aus D- und L-Äpfelsäure. Reine L-Äpfelsäure entsteht, wenn sie mit Hilfe von äpfelsäureproduzierenden Mikroorganismen bzw. bestimmten Enzymen hergestellt wird.
Problem
Kann bei Neugeborenen zu Stoffwechselstörungen führen, wenn der Verdauungsmechanismus noch nicht ausreichend entwickelt ist.
Zusatzinformationen
Bei der Herstellung ist der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen möglich.
Dieser Zusatzstoff ist gemäß der EG-Öko-Verordnung für die Herstellung von Bio-Lebensmitteln erlaubt.
Nanotechnische Herstellung möglich - Risikopotential wenig erforscht.
Datenquellen
Die Verbraucher Initiative e.V., www.zusatzstoffe-online.de (2024)
Persönliche Bewertung
Dieses Produkt ist für mich geeignet
Klima Score
 Nicht Verfügbar
Nicht Verfügbar

Wann ist der Klima Score verfügbar?
Dieser Klima Score ist leider gerade nicht verfügbar, da er noch berechnet oder gerade aktualisiert wird. Aber wir sind dran!
Wenn das Produkt für Dich wichtig ist, dann stimme mit ab. Die Produkte mit den meisten Stimmen werden als nächstes berechnet. So kannst Du uns helfen, den Klima Score immer weiter zu verbessern.
Warum braucht der Klima Score Deine Unterstützung?
In vielen Ländern sind sogenannte Lebensmittelampeln bereits Pflicht. Sie geben Auskunft über den Gehalt an Zucker, Fett oder Nährstoffen in einem Produkt.Wir von CodeCheck wünschen uns, dass dies auch für die Menge an CO2e-Emissionen gilt, die ein Produkt während seines Lebenszyklus verursacht.Dies würde uns allen ermöglichen, die Klimaauswirkungen von Lebensmitteln direkt im Supermarkt zu sehen, sie zu vergleichen und klimafreundliche Optionen wählen zu können.Es kann noch Jahre dauern, bis es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, diese Informationen auf der Packung zu zeigen.
Aber wir wollen nicht warten und nehmen die Sache selbst in die Hand.
Und was machen CodeCheck und Eaternity?
CodeCheck und Eaternity arbeiten zusammen, um einen Klima Score für Lebensmittel anzeigen zu können. Da das eine Menge Arbeit ist, können wir den Klima-Score bisher nur für eine begrenzte Anzahl von Produkten bereitstellen. Aber Du kannst uns helfen. Stimme für die Lebensmittel, die Du am meisten konsumierst und hilf uns den Klima Score immer besser und relevanter zu machen.
Du kannst darüber hinaus auch mit Lebensmittelherstellern in Kontakt treten und sie bitten, ihre Produktinformationen auf CodeCheck zu aktualisieren oder die CO2e-Informationen mit Eaternity zu verifizieren.