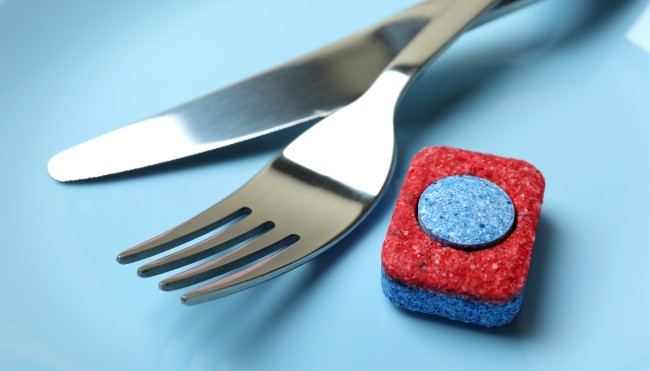Neue Forschungsmethoden, um Tierversuche zu ersetzen
Am 24. April ist Internationaler Tag zur Abschaffung von Tierversuchen. Auch in Deutschland werden jährlich an fast drei Millionen Tieren Versuche durchgeführt, die für Forschungszwecke bislang unverzichtbar sind. Forscher arbeiten jedoch bereits mit Erfolg an Alternativen – wir stellen Dir einige vor.
Tierversuche: Fluch oder Segen?
Tierschutz wird in Deutschland sehr groß geschrieben und ist sogar im Grundgesetz verankert. Keinem Tier darf ohne Grund Schmerz, Leid oder Schaden zugefügt werden – auch nicht im Rahmen von Tierversuchen.
Trotzdem werden immer noch Versuche an Tieren durchgeführt. Grund dafür ist, dass das Versuchstier als Modellorganismus in einigen Bereichen bislang unverzichtbar ist. Dazu zählen unter anderem Forschungen zu Krankheiten, die den ganzen Körper betreffen, wie zum Beispiel Krebs.
Tierversuche geben dabei wichtige Informationen darüber:
- ob und wie Medikamente wirken und
- ob einzelne Chemikalien für den Menschen giftig sind.
Tierversuche sind besonders streng geregelt
Tierversuchen sind in Deutschland rechtlich enge Grenzen gesetzt. Der Umgang mit Tieren ist im Versuchsbereich deutlich strenger geregelt, als zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im häuslichen Umfeld.
Jeder Tierversuch muss genehmigt werden. Außerdem gilt er nur dann als ethisch vertretbar, wenn er auf das nötige Maß beschränkt bleibt. So sind zum Beispiel Pharmaunternehmen bei der Wirkstoffprüfung dazu verpflichtet, Tierversuche zu vermeiden, wenn es geeignete Alternativmethoden gibt.
Kosmetische Endprodukte wie Körperpflege und Make-up dürfen in Deutschland seit 1998 generell nicht mehr an Tieren getestet werden. Ebenso sind Versuche mit Menschenaffen hierzulande seit 1991 nicht mehr erlaubt.
Staatlich geförderte Forschungsprojekte
Der Schutz des Tieres auf der einen und das Sicherheitsbedürfnis und Erkenntnisstreben des Menschen auf der anderen Seite – daraus ergibt sich ein Dilemma, wie das „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ (BMBF) schreibt.
Deshalb unterstützt das „BMBF“ seit 1980 Wissenschaftler, die Methoden zum Ersatz von Tierversuchen entwickeln. Bislang wurden rund 600 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt mehr als 190 Millionen Euro finanziert.
Die geförderten Vorhaben basieren auf dem sogenannten „3R“-Konzept:
1. Replacement – Ersatz
Oberstes Ziel ist es, Tierversuche komplett durch alternative Methoden zu ersetzen.
2. Reduction – Verringerung
Ist ein vollständiger Verzicht auf Tierversuche in einem Bereich noch nicht möglich, soll zumindest die Zahl der Versuchstiere auf ein Minimum beschränkt werden.
3. Refinement – Verfeinerung
Das Leiden der eingesetzten Tiere soll so weit wie möglich verringert werden. Ebenso versuchen die Forscher, aus dem einzelnen Tierversuch so viele Informationen wie möglich zu gewinnen.
Forschungsergebnisse für mehr Tierwohl
Die Forscher konnten bereits einige effiziente Ersatzmethoden für Tierversuche entwickeln. Dazu gehören unter anderem:
- Zellkulturverfahren,
- Computersimulationen,
- bildgebende Verfahren wie Kernspintomografie oder Ultraschall
- und Biochips.
Wir erklären Dir drei besonders relevante Alternativmethoden zu Tierversuchen.
1. Zellkulturverfahren
Sogenannte Zellkulturverfahren haben mittlerweile einen festen Platz als alternative Methode für Tierversuche. Dabei werden menschliche oder tierische Zellen im Labor so kultiviert, dass sie möglichst ähnlich wie im Körper funktionieren.
Mithilfe von dreidimensional wachsenden Zellkulturen können komplexe Strukturen wie lebendes Gewebe bis hin zu kompletten Organen nachgebaut werden.
Die Forschungen an den künstlichen Zellen gelingen zum Teil sogar besser als in Versuchen bei lebenden Tieren, weil sie flexibler, genauer und besser reproduzierbar sind.
So wurde bereits erfolgreich eine künstliche „menschliche“ Haut entwickelt, auf der die Wirkung von Arzneimitteln oder Chemikalien laut Experten verlässlicher getestet werden kann, als auf der Haut lebender Tiere.
2. Bildgebende Verfahren
Mit bildgebenden Verfahren wie Ultraschall und Kernspintomografie können zum einen krankhafte Veränderungen eines Organs beobachtet werden. Zum anderen ermöglichen sie Einblicke, wie Substanzen von Organen aufgenommen werden und dort wirken.
So helfen bildgebende Verfahren bei der Risikobewertung und Sicherheitsprüfung von Medikamenten und chemischen Substanzen sowie bei der Erforschung von Behandlungsmethoden, für die sonst Tierversuche zum Einsatz kommen.
Vor allem in Kombination mit Zellkulturverfahren haben bildgebende Verfahren eine sehr hohe wissenschaftliche Genauigkeit und Sicherheit.
3. Biochips
Ein neuerer Forschungsansatz versucht, die verschiedenen Organsysteme des menschlichen Körpers auf sogenannten Mikro- oder Biochips nachzubilden und miteinander zu vernetzen.
Dafür werden auf einem nur wenige Zentimeter großen Mikrochip Kammern angebracht, die mit lebenden Zellen ausgekleidet sind und so Organe im Kleinformat nachbilden. Die Zellen stammen aus medizinisch notwendigen Operationen bei Menschen.
Anhand der Biochips kann unter anderem überprüft werden, ob durch ein Medikament giftige Abbauprodukte oder schädliche Nebenwirkungen entstehen. Auch Krankheiten und mögliche Therapiemöglichkeiten können so erforscht werden.
Mit Biochips lassen sich dank automatisierter Abläufe große Mengen an Substanzen in kürzester Zeit messen. Darüber hinaus sind sie zuverlässig und preisgünstig.
Weiterführende Links:
- Bundesministerium für Bildung und Forschung: Alternativen zum Tierversuch
- MDR Wissen: Tierversuche und ihre Alternativen